Gut zu wissen

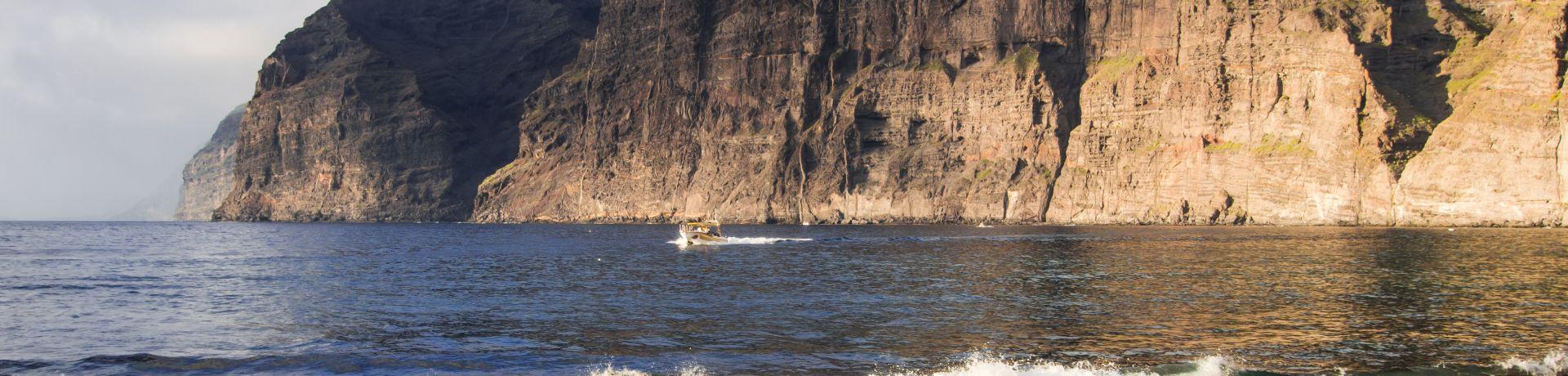

Wer sich für einen Urlaub auf den Kanaren entscheidet, hat zunächst die Qual der Wahl: Welche Insel passt zu mir? Schließlich gibt es neben den sieben Hauptinseln Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera und El Hierro auch sechs kleinere Eilande, wovon sich allein fünf um Lanzarote scharen. Wer noch nie auf dem Archipel war, dem bieten wir zehn gute Gründe, um doch einmal hinzureisen. Wer neugierig ist oder sich schon etwas auskennt, findet im Folgenden kuriose Fakten und Inspiration für eine neue Entdeckungsreise auf die Inseln.

Mit Santa Cruz de Tenerife und Las Palmas de Gran Canaria haben die Kanarischen Inseln gleich zwei Hauptstädte. Dass das so ist, liegt an den Eigenheiten der spanischen Verwaltung. Üblicherweise hat jede Autonome Region nur eine Hauptstadt – zum Beispiel Sevilla in Andalusien und Vitoria-Gasteiz im Baskenland. Verwaltungstechnisch steht jeder der Gemeinschaften ein Provinzialrat mit eigener Provinzverwaltung vor. Doch nicht nur sind die Kanaren bereits seit 1833 in die Provinzen Santa Cruz de Tenerife und Las Palmas de Gran Canaria aufgeteilt, zusätzlich sieht die Spanische Verfassung von 1978 für die Balearen und Kanaren eigene Inselregierungen vor. Somit bestehen die Kanaren zwar aus zwei Regionen mit jeweils eigener Hauptstadt, aber die Einteilung ist nahezu bedeutungslos, weil die Inselregierung am Ende doch für alle Inseln gemeinsam zuständig ist.

Aus dem deutschen Sprachraum kommend könnte man sich ja fragen, ob der Name der Kanarischen Insel nicht vielleicht doch etwas mit den Kanarienvögeln zu tun hat. Zumal auf Spanisch die Bezeichnung für die Vögel canarios noch näher an der für die Inseln islas canarias liegt. Doch es ist umgekehrt: Der Kanariengirlitz, der wilde, nicht-domestizierte Stammvater des Kanarienvogels hat seinen Namen von seinen Heimatinseln. Auch die Theorie, dass die Inseln nach dem lateinischen Wort für Hund, canis, benannt wurden, ist unwahrscheinlich. Möglich ist dagegen, dass der nordafrikanische Stamm der Canarii den Kanaren ihren Namen gegeben hat. Aber so ganz sicher weiß es dann doch keiner.

Der inseleigene Sport lucha canaria geht auf die ursprünglichen Bewohner der Kanaren, den Guanches zurück. Die ersten Aufzeichnungen zum Kanarischen Ringkampf stammen aus dem Jahr 1420. Einige der alten Regeln haben bis heute überlebt und vier- bis fünftausend Ringer in etwa hundert Vereinen auf allen Inseln messen sich bis heute im Ring. Dieser ist mit Sand bedeckt und besteht aus zwei konzentrischen Kreisen mit einem Durchmesser von 15 beziehungsweise 17 Metern. Gekämpft wird in kurzer Hose, T-Shirt und barfuß und im zwölfköpfigen Team. Jede Paarung ringt über drei, höchstens zwei Minuten andauernden Runden miteinander.

Karnevalisten, denen Köln zu kalt und Rio de Janeiro dann doch zu weit ist, sind in Santa Cruz de Tenerife genau richtig, denn neben der Karneval gilt als eine der Top-Sehenswürdigkeiten auf Teneriffa. Der Karneval in Santa Cruz hat eine jahrhundertelange Tradition, gilt als einer der größten und bekanntesten der Welt und ist tatsächlich einer der Gründe für die offizielle Partnerschaft zwischen Santa Cruz und Rio. Die Wahl der Karnevalskönigin am Mittwoch vor dem Karnevalswochenende läutet die Feierlichkeiten auf Teneriffa ein. Das eigentliche Spektakel beginnt dann mit einer extravaganten Straßenparade am Freitag, selbstverständlich angeführt von der Karnevalskönigin im opulenten, an Brasilien erinnernden Kostüm und ihren Damen und dauert eine knappe Woche bis in die Nacht vom Aschermittwoch. In dieser Zeit feiern die Menschen die Nächte auf den Straßen durch, während zahlreiche Musik- und Tanzgruppen im offiziellen Programm die Narren bei Laune halten.

Was in der Pfalz und Rheinhessen eine Straußenwirtschaft und in Schwaben ein Besen ist, ist auf Teneriffa ein Guachinche. Sie stammen noch aus der Zeit, als englische Händler bei den Winzern der Insel deren kompletten Ernteertrag aufkauften. Die Winzer luden die Käufer in ihre Weinkeller ein und servierten ihnen eine Kleinigkeit zu essen. Heute darf jeder in einem Guachinche essen gehen. Ähnlich wie in Deutschland richtet sich der Zeitraum, in dem die urigen Lokale geöffnet sind, nach der Weinernte und außer dem hauseigenen Wein gibt es meist eine begrenzte Auswahl an deftiger, fleischlastiger Hausmannskost und alles zu unschlagbar günstigen Preisen.

Wer auf Lanzarote unterwegs ist, kommt an César Manrique nicht vorbei. Genauer gesagt, an seinen Kunstwerken. Mal ziert eines seiner Windspiele einen Kreisverkehr, mal versteckt sich eines seiner Häuser in einem Lavafeld und über die ganze Insel verteilt hat er seine künstlerische Schaffenskraft in Form von Aussichtspunkten, Kaktusgärten oder dem spektakulären Konzertsaal Jameos de Agua verewigt. Aber auch absolute Kulturbanausen kommen an dem Werk des avantgardistischen Malers, Architekten und Bildhauers nicht vorbei. Denn der 1919 geborene und 1992 bei einem Autounfall verstorbene Künstler setzte sich Zeit seines Lebens für den Umweltschutz und nachhaltigen Tourismus auf Lanzarote ein. Es ist nicht zuletzt seinem unermüdlichen Einsatz zu verdanken, dass es auf Lanzarote keine Bettenburgen gibt, sondern nur Hotels, die in ihrer Höhe und Farbgebung die architektonischen Traditionen der Insel bewahren und achten.

Kaum nennenswerte Grundwasservorkommnisse und Niederschläge von gerade einmal 200 Millimetern pro Quadratmeter im Jahr machen Wasser auf Lanzarote seit jeher zu einem sehr kostbaren Gut. Noch in den 1950er-Jahren konnte ein Teil des Trinkwassers aus Stollen im Famara-Gebirge gewonnen werden, von denen die meisten inzwischen allerdings verbrackt sind. Neben der Landwirtschaft hat auch der erstarkende Tourismus die Wasserversorgung vor neue Herausforderungen gestellt: Ein Tourist verbraucht im Durchschnitt täglich fast doppelt so viel Wasser wie die Einheimischen auf den Kanaren. Andererseits haben die Urlauber den traditionell armen Inseln mehr Wohlstand beschert und neue Technologien schaffen Abhilfe. Auf Lanzarote, wo es besonders trocken ist, wird seit 1965 fast die komplette Trinkwasserversorgung über die Meerwasserentsalzungsanlage in der Inselhauptstadt Arrecife abgedeckt.

An den weitläufigen Dünen von Maspalomas auf Gran Canaria, genau dort, wo sich heute bekannte und weniger bekannte Reisende aus aller Herren Länder die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, schaute 1502 einer vorbei, dessen Bekanntheitsgrad über die Jahrhunderte Bestand hatte: Christopher Kolumbus. Der spanische Entdecker legte auf seiner letzten Reise in die neue Welt nochmal in Maspalomas an, um seine Wasservorräte aufzufüllen. Deshalb heißt die Straße in Richtung Strand bis heute Avenida de Cristóbal Colón.

Fuerteventura ist mit einem stolzen Alter von 20,6 Millionen Jahren nicht nur die älteste unter den kanarischen Inseln, sie ist streng genommen auch zwei Inseln in einer. Denn bevor Vulkanausbrüche der Insel ihre heutige Form gaben, war die Halbinsel Jandía im Süden ein eigenständiges Eiland. Die geographische Trennung war im 15. Jahrhundert auch politisch deutlich, als die Ureinwohner die Insel in zwei Königreiche eingeteilt hatten, die zudem von einer Mauer getrennt wurden: Maxorata im Norden und Jandía im Süden.

Wer auf La Gomera plötzlich ein Pfeifen im Ohr hat, muss sich nicht zwingend Sorgen machen, dass er sich ausgerechnet im Urlaub einen Tinnitus eingefangen hat. Denn tatsächlich leben auf der Insel nach Schätzungen etwa 20.000 Menschen, die El Silbo „sprechen“. Die Pfeifsprache ist ans Spanische gekoppelt, moduliert die Laute der Sprache allerdings in Pfiffe, um die Lautstärke zu erhöhen. So können sich die Inselbewohner tatsächlich über mehrere Kilometer Entfernung unterhalten, allerdings ist die Kommunikation im Vergleich zum üblichen Sprechen doch etwas eingeschränkt: Die drei Haupteigenschaften des Silbo Gomero sind Lautstärke, Tonhöhe und Unterbrechung, die kombiniert zwei Vokale und vier Konsonanten wiedergeben können.
Hinweis: CHECK24 übernimmt keine Garantie für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Die Inhalte unserer Artikel sind sorgfältig recherchiert und verfasst. Sie dienen als Inspiration, Information und stellen Empfehlungen der Redaktion dar. Dabei achten wir darauf, mit unseren Texten niemanden zu diskriminieren und beziehen in allen Formulierungen stets alle Menschen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität ein.